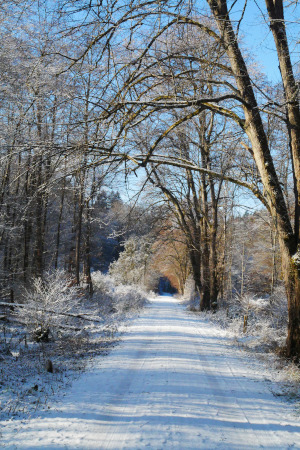Predigt zu Philipper 3,4b–14 aus der Sicht eines Prätorianers erzählt
Predigt zu Philipper 3,4b–14 am 9. Sonntag nach Trinitatis in der Dettenhäuser Johanneskirche am 16.08.2025 Hören wir auf unseren heutigen Predigttext aus dem Brief an die Philipper 3,4b-1 Einleitung Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben Worte des Paulus gehört – geschrieben aus dem Gefängnis.Er schreibt sie an die Gemeinde in Philippi, doch er schreibt sie auch mit Blick auf sich selbst: seine Geschichte, seinen Glauben, seine Hoffnung.Und er tut das nicht mit Stolz, sondern mit einer tiefen Demut, aus der…